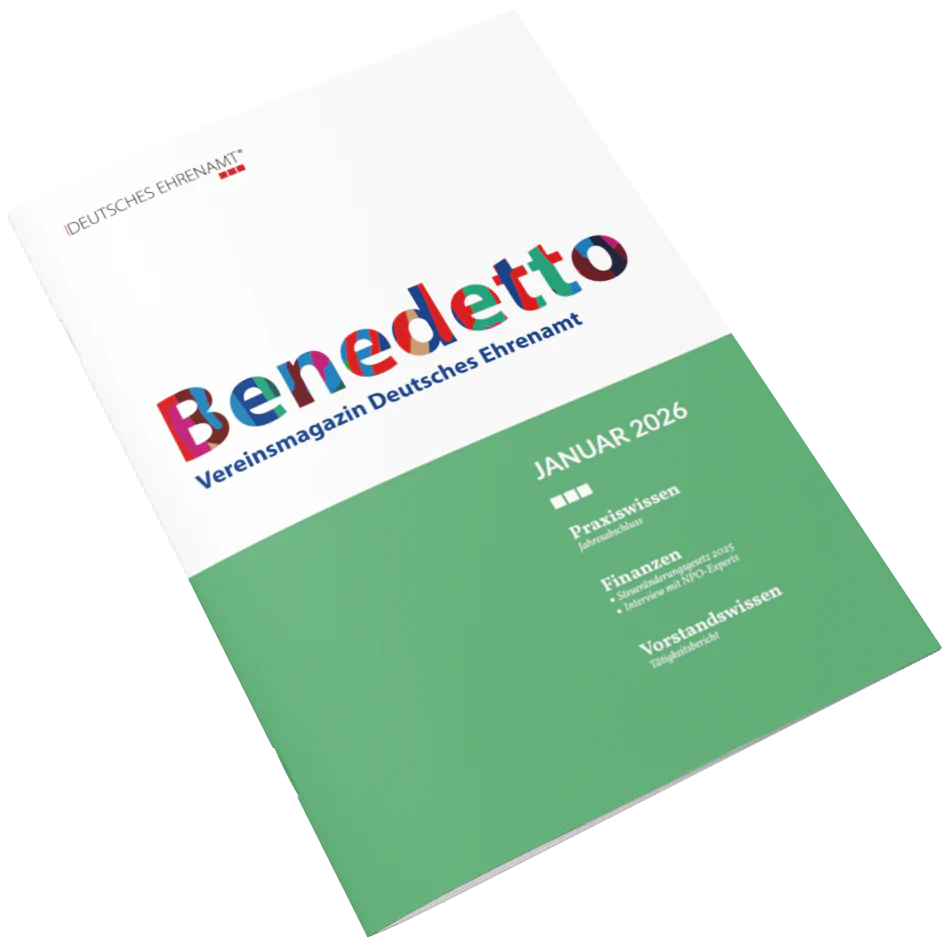Fall 1: Verein spendet
Eine Spende ist eine freiwillige Zuwendung in Geld oder Sachwerten an eine andere gemeinnützige Organisation – wichtig: ohne Gegenleistung. Der spendende Verein kann sich dafür eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) ausstellen lassen. Das ist besonders dann relevant, wenn der Verein selbst Spenden sammelt oder steuerlich absetzbare Ausgaben nachweisen möchte.
Wichtig: Eine Spende muss immer im Einklang mit der Satzung stehen.
Ein Beispiel:
Ein Verein, der selbst die Kinder- und Jugendhilfe fördert, führt eine Fortbildung durch und ein eingeladener Referent bittet im Anschluss darum, dass seine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 Euro nicht an ihn selbst, sondern stattdessen an eine Kinderhilfsorganisation gespendet wird. Der Vorstand beschließt, diesem Wunsch nachzukommen und spendet die 150 Euro aus Vereinsmitteln – freiwillig und ohne vertragliche Verpflichtung. Anschließend stellt die Kinderschutzorganisation dem Verein eine Zuwendungsbestätigung aus.
Das ist eine klassische Spende, weil:
- Der Referent den Wunsch geäußert hat, seine Aufwandsentschädigung zu spenden. Er hat die Spende nicht zur Bedingung gemacht.
- Sowohl der spendende Verein als auch die empfangende Organisation verfolgen Zwecke, die miteinander kompatibel sind.
Fall 2: Mittelweitergabe
Von einer Mittelweitergabe ist dann die Rede, wenn ein gemeinnütziger Verein eigene Mittel – z.B. Spenden oder Mitgliedsbeiträge – nicht selbst für seine satzungsgemäßen Zwecke einsetzt, sondern sie gezielt an eine andere gemeinnützige Organisation weiterleitet, damit diese damit entsprechende Projekte umsetzt.
Wichtig: Die Mittelweitergabe ist nur dann erlaubt, wenn beide Vereine gemeinnützig sind und der empfangende Verein die Mittel ausschließlich für Zwecke einsetzt, die auch in der Satzung des sendenden Vereins enthalten oder damit vereinbar sind (§ 58 Nr.2 AO).
Die Mittelweitergabe ist also kein Spendenakt im klassischen Sinne, sondern eine gezielte Zweckverwirklichung durch Dritte – im Auftrag des gebenden Vereins, aber mit eigener operativer Umsetzung durch den Empfängerverein.
Ein Beispiel:
Ein Verein, der sich der Umweltbildung verschrieben und bietet regelmäßig Workshops für Schulklassen an. Im aktuellen Jahr möchte er ein Bildungsprojekt zum Thema „Wald und Klima“ in einer ländlichen Region fördern, kann es aber logistisch nicht selbst durchführen.
Daher beschließt der Vorstand, 3.000 Euro an einen Verein weiterzugeben, der in derselben Region bereits aktiv ist und die Workshops im Sinne des Konzepts umsetzen kann. Dafür wird keine Zuwendungsbestätigung ausgestellt.
Hier handelt es sich um Mittelweitergabe, weil:
- Beide Vereine fördern satzungsgemäß die Umweltbildung und den Naturschutz fördern.
- Das Geld nicht frei gespendet wird, sondern gezielt für ein Bildungsprojekt.
- Die Verantwortung für den korrekten Einsatz der Mittel bleibt beim Mittelgebenden.
Falls Sie sich fragen, wie weit wohl die Verantwortung für den korrekten Einsatz der Mittel geht, hier eine kleine Einordnung dazu.
Keine Angst, als Mittelgeber müssen Sie nicht dem Mittelempfänger nicht abverlangen, Originalbelege vorzulegen oder gar die Buchhaltung prüfen zu lassen. Vielmehr muss der Vorstand des Mittelgebers gegenüber dem Finanzamt nachweisen können, dass die Organisation sorgfältig ausgewählt wurde und Maßnahmen getroffen wurden, die Mittelverwendung zu kontrollieren. Eine Maßnahme könnte sein, mit dem Empfänger schriftlich konkret zu vereinbaren, wofür konkret die Mittel eingesetzt werden müssen.
Passend zum obigen Beispiel könnte eine Vereinbarung wie folgt lauten:
„Die Mittel in Höhe von 3.000 Euro sind ausschließlich für die Durchführung der Umweltbildungsaktion „Grünes Klassenzimmer im Raum Musterhausen zu verwenden“.
Damit minimieren Sie das Risiko, selbst als Vorstand ins Fadenkreuz des Finanzamts zu gelangen, wenn der Mittelempfänger auf die Idee kommt, mit einem Teil der Mittel auch noch akute Haushaltslöcher zu stopfen.
Tipp: Spenden und Mittelweitergabe bergen immer auch Risiken. Diese lassen sich minimieren, indem Sie sich im Zweifel Rat bei Anwälten mit einem guten Auge für das Vereinsrecht einzuholen und Fehler die aus der Vorstandstätigkeit resultieren, mit einer D&O-Versicherung abzusichern.