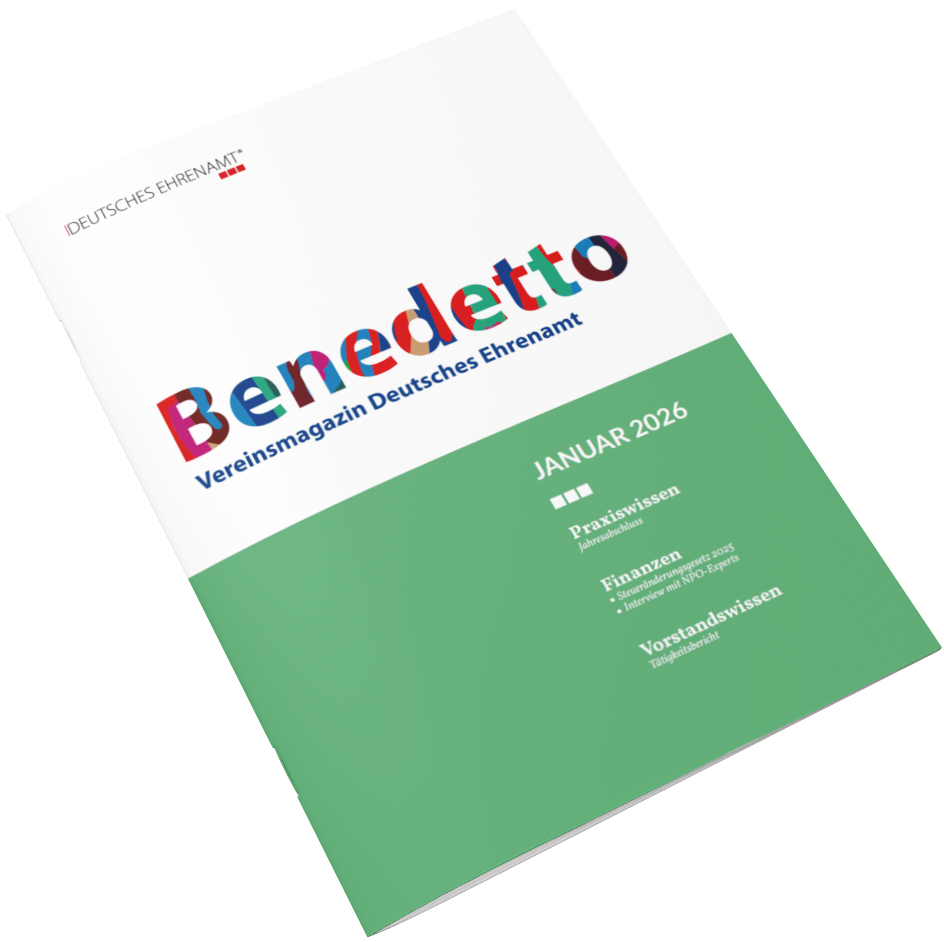Die Satzung eines Vereins ist nicht nur ein juristischer Pflichttext – sie ist das Fundament für die tägliche Vereinsarbeit. Überlegt getroffene Regelungen zum Vorstand strukturieren und erleichtern die Arbeit der Verantwortungsträger. Schon bei der Vereinsgründung sollte überlegt werden: Wer darf hinein, wie viele Köpfe braucht es, wie wird entschieden? Gute Antworten auf diese Fragen ersparen dem Verein später viel Stress. Der folgende Beitrag richtet sich nicht nur an Vereinsgründer. Auch bestehende Satzungen sollten auf aktuelle Entwicklungen hin angepasst werden.
Wer gehört in den Vorstand?
Das Bürgerliche Gesetzbuch (§ 26 BGB) macht es kurz: Jeder Verein braucht einen Vorstand. Wie viele Personen dazugehören, welche Aufgaben sie haben oder wer den Verein nach außen vertritt – das alles bleibt Sache der Satzung und bietet Möglichkeiten zu gestalten.
Häufig regeln Satzungen die Vorstandsbesetzung so: „Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kassenwart und dem Schriftführer.“ Das muss aber nicht so sein. Flexibler wäre folgende Regelung: „Der Vorstand besteht aus mindestens zwei, höchstens fünf Personen.“ Gerade Vereine mit Problemen bei der Nachfolge profitieren davon, denn wenn mal nicht alle Posten besetzt werden können, bleibt der Vorstand trotzdem handlungsfähig.
Wer macht was?
Ob Vorsitz, Schriftführung oder Finanzen – es ist sinnvoll, die Aufgabenbereiche im Vorstand zu regeln. Aber: Die Satzung muss das nicht im Detail festlegen. Oft reicht eine grobe Gliederung. Es ist empfehlenswert, die Details in einer Geschäftsordnung festzulegen. Diese kann nämlich auch ohne Mitgliederversammlungsbeschluss geändert werden und wird auch nicht beim Registergericht eingetragen. Das schafft die Freiheit, Aufgabenverteilungen anzupassen, wenn der Vorstand dies für nötig befindet und einen Beschluss dazu fasst.
Achtung: Regelt die Satzung, dass die Mitgliederversammlung über die Geschäftsordnung beschließen muss, gilt dies.
Wer darf den Verein vertreten?
Standardmäßig ist in Satzungen geregelt, dass mehrere Vorstandsmitglieder den Verein gemeinsam vertreten. Die Satzung kann aber auch hier andere Wege gehen.
Satzungsregel mit klarer Struktur:
„Der Vorsitzende ist alleinvertretungsberechtigt, die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils zu zweit.“
Neutralere Form:
„Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.“
Wichtig: Bedingte Vertretungsrechte („wenn der Vorsitzende krank ist, darf…“) sind nicht zulässig. Solche Klauseln erkennt das Vereinsregister nicht an.
Amtszeit
Meist wird eine bestimmte Amtszeit (z. B. zwei Jahre) in der Satzung vorgesehen. Damit der Vorstand nach dem Ablauf der Amtszeit nicht plötzlich „ohne Amt“ dasteht, sollte eine Übergangsregelung in die Satzung eingefügt werden. Als sinnvoller Zusatz erweist sich hierfür „Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.“
Es gibt sogar die Möglichkeit, den Vorstand auf unbestimmte Zeit zu wählen mit der Ergänzung, dass jederzeit eine Neuwahl durchzuführen ist, wenn z. B. 20 % der Mitglieder dies beantragen.
Vorzeitiges Amtsende
Jeder ehrenamtlich tätige Vorstand darf sein Amt ohne Grund vor Ende der Amtszeit niederlegen – außer, der Verein würde dadurch handlungsunfähig. Fällt also aus welchem Grund auch immer ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit weg, muss, wenn keine Regelung in der Satzung getroffen wurde, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und der Vorstand per Wahl ergänzt werden.
Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist oft nicht kurzfristig möglich und generell sehr zeitaufwändig. Daher bietet es sich an, den Satzungsjoker zu ziehen, nämlich, dass sich der Vorstand selbst ergänzt (Kooptation).
In der Satzung könnte das so geregelt werden:
„Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, beruft der verbleibende Vorstand ein neues Mitglied bis zur nächsten ordentlichen Wahl.“
Alternativ kann auch vorübergehend ein anderes Mitglied ein zusätzliches Amt übernehmen – z. B. wenn der Kassenwart ausscheidet und der Vorsitzende die Aufgaben übergangsweise mitübernimmt.
In der Satzung könnte das so geregelt werden:
„Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor Ablauf der Amtsperiode aus, kann ein anderes Vorstandsmitglied dessen Aufgaben kommissarisch übernehmen. Die kommissarische Übernahme gilt bis zur nächsten ordentlichen Neuwahl des Vorstands oder bis zur Nachwahl durch die Mitgliederversammlung. Der Vorstand gilt in dieser Zeit als entsprechend verkleinert.“
Wer bestellt den Vorstand?
Regulär wählt die Mitgliederversammlung den Vorstand. In größeren oder strukturierten Vereinen kann man auch mit einem Aufsichtsrat arbeiten, der den Vorstand bestellt. Ebenso ist es möglich, dass ein Kernvorstand gewählt wird, der sich ergänzt – z. B. um Experten oder Nachwuchskräfte in den Vorstand zu holen.
Hier ein Vorschlag zur Formulierung: „Der Kernvorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Dieser beruft bis zu zwei weitere Vorstandsmitglieder.“
Wie wird gewählt?
Rein rechtlich gilt: Einzelwahl mit absoluter Mehrheit.
Wer das vereinfachen will, sollte es in der Satzung festlegen:
- Blockwahl: Alle Vorstände werden gemeinsam gewählt
- Relative Mehrheit: Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt
- Stichwahl: Bei Gleichstand wird nochmal zwischen den beiden Bestplatzierten abgestimmt
Das spart Zeit – besonders, wenn ohnehin nicht mehr Kandidaten als Ämter vorhanden sind.
Wer darf in den Vorstand?
Grundsätzlich darf jeder für den Vorstand kandidieren und gewählt werden. Auch Nichtmitglieder. Die Satzung kann das einschränken. Allerdings sollte hier mit Weitblick agiert werden. Daher sollte im Vorfeld überlegt werden, was passiert, wenn die Voraussetzung wegfällt und dafür eine entsprechende Regelung einsetzen.
Mögliche Einschränkungen:
- „Nur Vereinsmitglieder sind wählbar.“
- „Wählbar sind nur Mitglieder, die seit mindestens drei Jahren im Verein sind.“
- „Angestellte des Vereins dürfen nicht in den Vorstand gewählt werden.“
- „Vorstandsmitglied muss der Berufsgruppe xy angehören.“
Aber Achtung: Darf der Vorstandsvorsitz nur von einem Angehörigen einer Berufsgruppe besetzt werden, muss für den Fall des Renteneintritts oder der Berufsaufgabe in der Satzung vorgesorgt werden.
Abberufung
Laut Gesetz geht das jederzeit. Die Satzung kann und darf das nicht verhindern, aber gegen willkürliches Handeln absichern. Um den Vorstand vor Willkür zu schützen und die Macht der Mitgliederversammlung zu stärken dienen diese beiden Formulierungsbeispiele: „Nur aus wichtigem Grund“ und „Nur mit 3/4-Mehrheit der Mitgliederversammlung“.
Wer schon mal Lagerbildung und Streitigkeiten im Verein erlebt hat, weiß, wie sinnvoll und hilfreich diese Regelungen sein können.
Entscheidungsfindung
Ohne abweichende Regelung gilt für die Entscheidungsfindung des Vorstands das gleiche Verfahren wie bei der Mitgliederversammlung:
Einladung mit Tagesordnung zur Sitzung mit Anwesenheit und Beschluss nur zu angekündigten Punkten. Deutlich moderner und flexibler ist, wer digitale Abstimmungen erlaubt. Außerdem können auf diese Weise auch kurzfristig Entscheidungen gefällt werden.
Die Satzung müsste hierfür folgende Formulierung vorsehen:
„Beschlüsse des Vorstands können auch per E-Mail, telefonisch oder über digitale Konferenzen gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen.“
Stimmengleichheit
Besteht der Vorstand aus einer geraden Anzahl an Personen, dann muss eine Regel her, die dafür sorgt, dass auch bei Stimmengleichheit kein Stillstand entsteht.
In einer Patt-Situation sorgt die Regelung für einen Stichentscheid für Klarheit:
Beispielsweise: „Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.“
Interessenkonflikte
Gesetzlich dürfen Vorstandsmitglieder bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, nicht mitstimmen, bspw. wenn zur Debatte steht, dass ein Vorstandsmitglied etwas an den Verein verkaufen oder vermieten soll. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann die Satzung hier sogar weiter greifen, indem das Stimmverbot auf Geschäfte mit Ehepartnern oder Verwandten ausgeweitet wird.
Etwa so: „Das Stimmverbot gilt auch bei Verträgen mit Ehepartnern oder Verwandten bis zum zweiten Grad.“